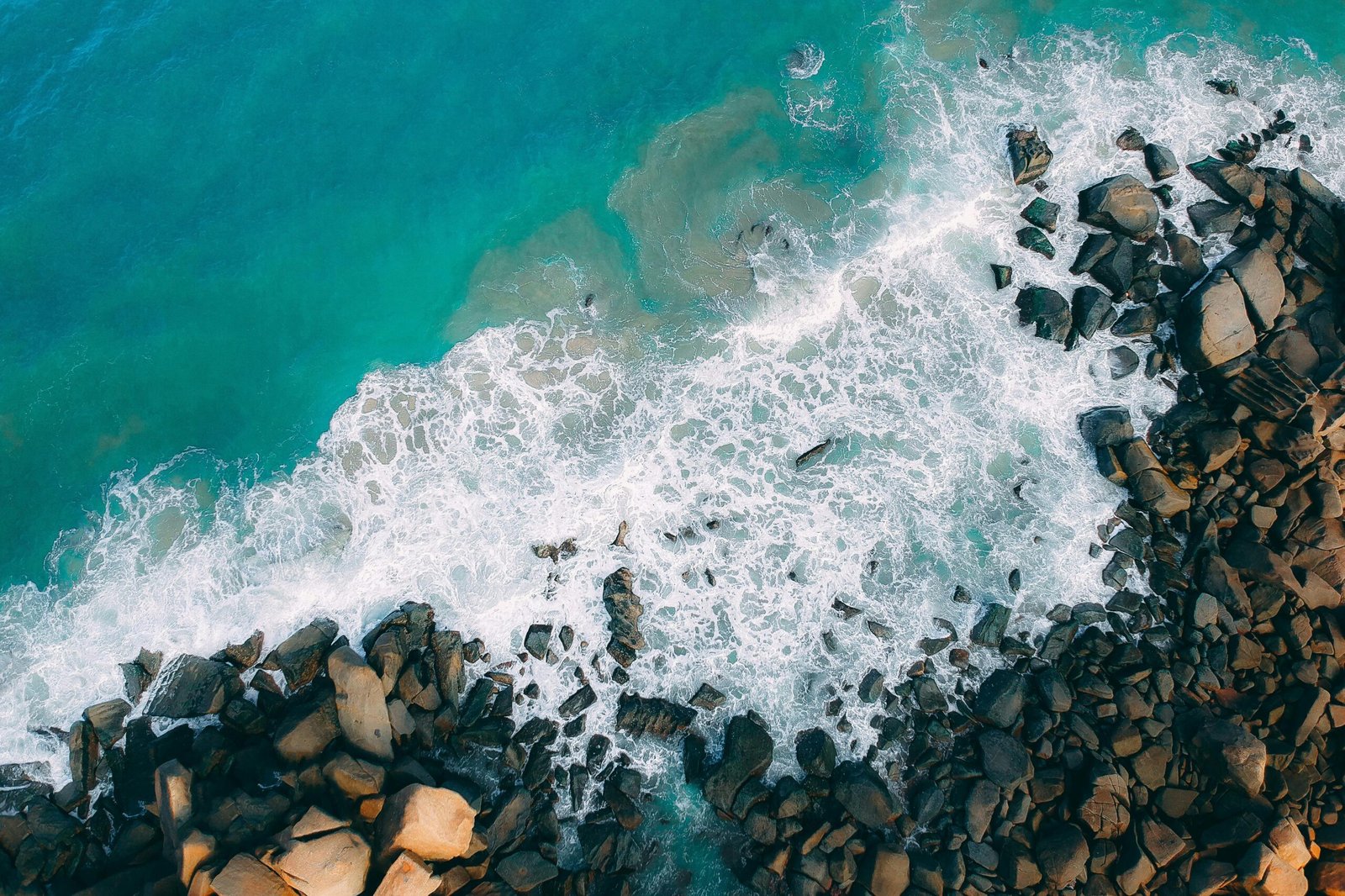EU Drohnenverordnung 2025: Was gilt in Deutschland?
Die EU-Drohnenverordnung 2025 bringt einheitliche Regeln für Drohnen in Europa und ersetzt in Deutschland die bisherigen nationalen Vorschriften. Hier sind die wichtigsten Änderungen und Anforderungen:
- Kategorien: Drohnenflüge werden in Open (geringes Risiko), Specific (mittleres Risiko) und Certified (hohes Risiko) eingeteilt.
- Mindestalter: Drohnenpiloten dürfen ab 14 Jahren eine Lizenz in der Open-Kategorie beantragen.
- Lizenzen:
- A1/A3-Zertifikat: Für Drohnen ab 250 g (Kosten: 30–60 €).
- A2-Zertifikat: Für Flüge in bebauten Gebieten mit Drohnen bis 2 kg (Kosten: 200–500 €).
- Registrierung: Drohnen ab 250 g oder mit Kamera müssen beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) registriert werden (Gebühren: 20–50 €).
- Versicherung: Ab November 2025 ist eine Haftpflichtversicherung für Drohnen über 250 g Pflicht.
- Flugverbotszonen: Neue geografische Beschränkungen wurden eingeführt, die strikt einzuhalten sind.
- Strafen: Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 50.000 € geahndet werden.
Schnellübersicht der Anforderungen:
| Anforderung | Hobbypilot | Gewerblicher Betreiber |
|---|---|---|
| Lizenz | A1/A3 (falls nötig) | A2 (bei höheren Risiken) |
| Registrierung | Ab 250 g oder Kamera | Immer erforderlich |
| Versicherung | Ab 250 g, 30–100 €/Jahr | 200–500 €/Jahr |
| Flugbeschränkungen | Standard-No-Fly-Zonen | Zusätzliche Genehmigungen nötig |
Die neuen Regeln sollen den Drohnenbetrieb sicherer und EU-weit einheitlich gestalten. Drohnenpiloten sollten sich rechtzeitig informieren und ihre Lizenzen, Registrierungen und Versicherungen vorbereiten.
Drohnen-Gesetze 2025: Alle Regeln für Drohnen Piloten für DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 4K & Neo
Was sich in der Verordnung 2025 geändert hat
Die EU-Drohnenverordnung 2025 bringt einige Änderungen mit sich, die für Drohnenpiloten in Deutschland von Bedeutung sind. Ziel dieser Anpassungen ist es, die Sicherheit im Luftraum zu erhöhen und einheitliche Standards innerhalb der EU zu schaffen[3]. Im Folgenden werden die wichtigsten Neuerungen erläutert.
Eine zentrale Änderung betrifft das Mindestalter für Drohnenpiloten. Ab 2025 können Jugendliche ab 14 Jahren eine Drohnenlizenz in der Open-Kategorie beantragen, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen[3]. Damit wird es jungen Menschen ermöglicht, früher in die Welt der Drohnentechnologie einzutauchen.
Zusätzlich führt die Verordnung neue geografische Flugverbotszonen ein, um die Sicherheit im Luftraum weiter zu gewährleisten[3]. Diese Zonen sind klar definiert und für alle Piloten verbindlich. Gleichzeitig erhalten Behörden erweiterte Befugnisse für Kontrollen und Inspektionen[3], um die Einhaltung der Vorschriften konsequenter durchzusetzen.
Neue Zertifizierungsanforderungen
Ein wesentlicher Bestandteil der Verordnung 2025 ist ein zweistufiges Zertifizierungssystem, das sich nach dem Gewicht und Einsatzbereich der Drohne richtet. Ziel ist es, den zivilen Luftraum sicherer zu gestalten.
Für Drohnen ab 250 Gramm ist das A1/A3-Zertifikat verpflichtend[4][5]. Wer in bebauten Gebieten fliegen möchte, benötigt das anspruchsvollere A2-Zertifikat. Dieses richtet sich an Piloten, die Drohnen zwischen 500 Gramm und 2 Kilogramm in sensibleren Bereichen einsetzen möchten[4].
| Zertifikat | Beschreibung | Anforderungen |
|---|---|---|
| A1-A3 | Basiszertifikat | Pflicht für Drohnen von 250 Gramm bis 25 Kilogramm[4] |
| A2 | Erweiterungszertifikat | Für Drohnen von 500 Gramm bis 2 Kilogramm, speziell in bebauten Gebieten[4] |
Die Kosten für das A1/A3-Zertifikat liegen zwischen 30 € und 60 € und umfassen eine Online-Schulung sowie eine theoretische Prüfung[1]. Das A2-Zertifikat ist mit 200 € bis 500 € deutlich teurer, da neben einer erweiterten Schulung auch eine praktische Prüfung erforderlich ist[1].
Alle Drohnen über 250 Gramm oder mit Kameras müssen bei der Bundesanstalt für Luftfahrt (LBA) registriert werden[1]. Die Registrierungsgebühr beträgt zwischen 20 € und 50 € pro Drohne[1]. Verstöße gegen diese Vorschriften können mit Bußgeldern von bis zu 50.000 € geahndet werden[1].
Ende der Übergangszeit
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Ende der bisherigen Übergangsregelungen. Seit dem 1. Januar 2023 gelten ausschließlich die EU-Verordnungen 2019/947 und 2019/945 für alle Operationen in der Open-Kategorie[2].
Die deutschen Drohnenlizenzen nach §21d LuftVO verloren ihre Gültigkeit am 31. Dezember 2023[6]. Drohnen ohne EU-Standardklassifizierung durften nur bis zum 31. Dezember 2022 unter bestimmten Bedingungen in der Open-Kategorie betrieben werden[7]. Ab dem 1. Januar 2024 dürfen nur noch Drohnen mit C-Klassifizierung in der Specific-Kategorie eingesetzt werden[8].
Aktualisierte Risikokategorien
Die Verordnung 2025 führt auch eine überarbeitete Einstufung der Risiken ein. Drohnenoperationen werden nun in drei Kategorien eingeteilt: Open (geringes Risiko), Specific (mittleres Risiko) und Certified (hohes Risiko). Diese Einteilung orientiert sich nicht an der Nutzung – privat oder gewerblich –, sondern berücksichtigt das Gewicht, die technischen Spezifikationen und den Einsatzzweck der Drohne[2].
Ab November 2025 wird zudem eine Haftpflichtversicherung für alle Drohnen über 0,25 Kilogramm verpflichtend[3]. Diese Regelung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Drohnentechnologie und die Verantwortung, mögliche Schäden abzusichern.
Lizenzierung, Registrierung und Versicherung in Deutschland
In Deutschland orientieren sich die gesetzlichen Vorgaben für Drohnen an den EASA-Standards [1]. Diese umfassen drei zentrale Bereiche: Pilotenlizenzen, die Registrierung von Drohnen und Betreibern sowie die Haftpflichtversicherung.
Drohnenpilotenlizenz
In Deutschland gibt es zwei Haupttypen von Drohnenlizenzen: das EU-Kompetenzzeugnis (A1/A3-Zertifikat) und das EU-Fernpilotenzertifikat (A2-Zertifikat) [1]. Welche Lizenz benötigt wird, hängt vom Gewicht der Drohne und deren Einsatzgebiet ab.
- A1/A3-Zertifikat: Geeignet für Drohnen zwischen 250 Gramm und 25 Kilogramm, die in Gebieten mit geringem Risiko betrieben werden. Es erfordert eine Online-Schulung mit einer theoretischen Prüfung und kostet zwischen 30 € und 60 € [1].
- A2-Zertifikat: Wird für Einsätze mit höherem Risiko benötigt. Hier sind eine theoretische und eine praktische Prüfung erforderlich, die Kosten liegen zwischen 200 € und 500 € [1].
Die Schulungen umfassen Themen wie Luftverkehrsrecht, Betriebssicherheit, Wetterkunde und Notfallmaßnahmen [1]. Das Fernpilotenzertifikat ist fünf Jahre gültig [2] und muss rechtzeitig erneuert werden. Nach Abschluss der Lizenzierung folgt die Registrierung bei der zuständigen Behörde.
Betreiber- und Drohnenregistrierung
Drohnenbetreiber müssen sich beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) registrieren, wenn ihre Drohne 250 Gramm oder mehr wiegt oder mit einer Kamera bzw. einem Sensor ausgestattet ist, der persönliche Daten erfassen kann [5] [9]. Nach der Registrierung erhalten Betreiber eine elektronische Registrierungsnummer (e-ID), die gut sichtbar an jeder Drohne angebracht werden muss [5] [9].
Die Gebühren für die Registrierung betragen 20,00 € für Privatpersonen und 50,00 € für juristische Personen [9]. Die Registrierung erfolgt online über das Portal des Luftfahrt-Bundesamts.
| Anforderung | Privatperson | Juristische Person |
|---|---|---|
| Vollständiger Name | Erforderlich | Erforderlich |
| Geburtsdatum | Erforderlich | Nicht zutreffend |
| Gültiges Ausweisdokument | Scan von Personalausweis/Reisepass | Scan eines offiziellen Dokuments |
| Adresse | Erforderlich | Erforderlich |
| E-Mail-Adresse | Erforderlich | Erforderlich |
| Telefonnummer | Erforderlich | Erforderlich |
| Versicherungsinfo | Name des Versicherers, Policennummer | Name des Versicherers, Policennummer |
Die e-ID ist EU-weit gültig [11], was grenzüberschreitende Drohnenflüge erleichtert. Für Besucher aus Nicht-EU-Staaten ist eine Registrierung bei der Luftfahrtbehörde des ersten EASA-Mitgliedsstaates erforderlich, in dem sie operieren möchten [10].
Haftpflichtversicherungsanforderungen
Seit 2005 ist eine Haftpflichtversicherung für Drohnen in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Sie deckt Schäden an Personen, Sachwerten und Vermögensgegenständen ab [12]. In Deutschland gibt es rund 415.000 Drohnen, von denen etwa 80 % privat genutzt werden [12].
Die empfohlene Mindestversicherungssumme liegt bei 50 Millionen Euro [12], da Schäden durch Drohnen schnell Millionenbeträge erreichen können.
- Private Haftpflichtversicherungen: Kosten etwa 30 € pro Jahr.
- Gewerbliche Versicherungen: Liegen bei etwa 120 € jährlich.
- Privathaftpflicht mit Drohnenabdeckung: Ca. 40 € pro Jahr für Singles und 60 € für Familien [12].
Beim Fliegen einer Drohne muss der Versicherungsnachweis stets mitgeführt werden [13]. Verstöße gegen die Vorschriften des Luftfahrt-Bundesamts können den Versicherungsschutz ungültig machen [12]. Wer bereits eine Privathaftpflichtversicherung besitzt, sollte prüfen, ob diese auch die Nutzung von Drohnen umfasst. Falls nicht, ist eine separate Drohnenhaftpflichtversicherung erforderlich [12].
Lizenzierung, Registrierung und Versicherung bilden zusammen die Grundlage für den sicheren und gesetzeskonformen Betrieb von Drohnen in Deutschland.
Betriebskategorien richtig befolgen
Nachdem die grundlegenden Regelungen vorgestellt wurden, folgt nun die praktische Einteilung der Drohneneinsätze in die drei Betriebsarten. Die Verordnung teilt Drohneneinsätze in drei Kategorien ein, die sich nach dem jeweiligen Risiko und den Einsatzbedingungen unterscheiden. Der erste Schritt ist immer eine Risikobewertung. Einsätze mit geringem Risiko, die einfache Sicherheitsregeln einhalten, fallen meist in die offene Kategorie.
Offene Kategorie: Einsätze mit geringem Risiko
Die offene Kategorie richtet sich an Drohneneinsätze mit niedrigem Risiko, wie sie bei den meisten Hobbyflügen und vielen gewerblichen Anwendungen vorkommen. Hier gelten klare Vorgaben: Drohnen dürfen maximal 25 kg wiegen, nicht höher als 120 Meter fliegen und müssen stets in Sichtweite (VLOS) betrieben werden [17].
Innerhalb der offenen Kategorie gibt es drei Unterkategorien (A1, A2, A3), die sich nach der Drohnenklasse und der Nähe zu Personen unterscheiden [14]:
- A1: Erlaubt Flüge über Personen, jedoch nicht über Menschenansammlungen (gilt für C0- und C1-Drohnen).
- A2: Gilt für Flüge nahe Personen, jedoch mit einem Mindestabstand von 30 Metern (C2-Drohnen).
- A3: Für Einsätze fernab von Personen, mit einem Mindestabstand von 150 Metern zu Schutzzonen.
Für die Unterkategorien A1 und A3 benötigen Sie das EU-Kompetenzzeugnis A1/A3, während für A2 ein EU-Fernpilotenzertifikat erforderlich ist. Zusätzlich müssen die meisten Drohnen in dieser Kategorie mit Fernidentifikationssystemen ausgestattet sein, damit Behörden sie während des Fluges identifizieren können [14].
Spezifische Kategorie: Mittleres Risiko
Wenn ein Drohneneinsatz die Grenzen der offenen Kategorie überschreitet – etwa bei Flügen außerhalb der Sichtweite (BVLOS), über Menschenansammlungen oder in kontrollierten Lufträumen – fällt er in die spezifische Kategorie [15]. Hier ist eine individuelle Risikobewertung erforderlich, und es muss eine Betriebsgenehmigung beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) beantragt werden [15].
Es gibt drei Ansätze, um eine solche Genehmigung zu erhalten:
- Standardszenarien (STS): Vorgegebene Einsatzarten mit bereits definierten Risikobewertungen, die den Genehmigungsprozess erleichtern.
- Vordefinierte Risikobewertungen (PDRA): Standardisierte Bewertungen für bestimmte Einsatztätigkeiten, die als Grundlage für die Genehmigung dienen.
- Spezifische Betriebsrisikobewertung (SORA): Ein detaillierter Ansatz, bei dem eine individuelle Risikobewertung für komplexe oder neuartige Einsätze erstellt wird [16].
Die Bearbeitung solcher Anträge kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Es ist daher ratsam, ausreichend Zeit einzuplanen und frühzeitig das LBA zu kontaktieren [15].
Zertifizierte Kategorie: Hochrisiko-Einsätze
Die zertifizierte Kategorie umfasst Einsätze mit hohem Risiko, wie etwa den Transport von Personen oder Gefahrgut. Hier sind umfangreiche Zertifizierungen, ein Sicherheitsmanagementsystem und regelmäßige Inspektionen erforderlich [15]. Die Anforderungen orientieren sich an den Standards der kommerziellen Luftfahrt und beinhalten speziell geschultes Personal.
Einsätze in dieser Kategorie sind noch selten, da die meisten kommerziellen Anwendungen in die offene oder spezifische Kategorie fallen. Sollten Sie jedoch Passagiere transportieren oder andere Hochrisiko-Aktivitäten planen, ist es notwendig, sich direkt an das LBA zu wenden, um die genauen Zertifizierungsanforderungen zu klären [15]. Beachten Sie, dass sowohl die Kosten als auch der organisatorische Aufwand in dieser Kategorie deutlich höher sind als bei den anderen Betriebsarten.
Auswirkungen auf Hobbypiloten und gewerbliche Betreiber
Die EU-Drohnenverordnung 2025 bringt neue Vorgaben für Hobbypiloten und gewerbliche Betreiber mit sich. Während die Grundprinzipien für alle gelten, unterscheiden sich die Anforderungen je nach Einsatzzweck deutlich. Hier ein Überblick über die wichtigsten Regelungen für Freizeit- und kommerzielle Flüge.
Freizeitflüge
Seit 2025 gelten für Hobbypiloten strengere Regeln. Drohnen, die entweder mehr als 250 Gramm wiegen oder mit einer Kamera ausgestattet sind, müssen registriert werden. Die Registrierungsgebühr liegt zwischen 20 und 50 €. Außerdem ist für Drohnen ab 250 Gramm das EU-Kompetenzzeugnis Pflicht. Die dafür notwendige Online-Schulung inklusive Prüfung kostet zwischen 30 und 60 € [1]. Wer diese Vorgaben ignoriert, riskiert Bußgelder von bis zu 50.000 € [1].
Zusätzlich ist eine Haftpflichtversicherung für alle Drohnenflüge in Deutschland vorgeschrieben. Für Hobbypiloten bewegen sich die jährlichen Kosten dafür zwischen 30 und 100 € [1]. Beim Fliegen müssen außerdem Mindestabstände von 100 Metern zu Krankenhäusern, Gefängnissen, Industrieanlagen und anderen sensiblen Bereichen eingehalten werden [18].
Die meisten Freizeitflüge fallen in die sogenannte offene Kategorie. Diese erlaubt eine maximale Flughöhe von 120 Metern und erfordert, dass die Drohne stets in Sichtweite bleibt [18]. Besonders in städtischen Gebieten ist eine sorgfältige Flugplanung unerlässlich, um No-Fly-Zonen zu vermeiden.
Gewerbliche Drohneneinsätze
Für gewerbliche Betreiber sind die Anforderungen deutlich komplexer. Abhängig von der Einsatzart ist das EU-Fernpilotenzertifikat erforderlich, das auch eine praktische Prüfung beinhaltet [1]. In Deutschland verdienen Drohnenpiloten im Schnitt zwischen 35.000 und 50.000 € jährlich [1].
Auch die Haftpflichtversicherung fällt für gewerbliche Einsätze teurer aus, mit jährlichen Kosten zwischen 200 und 500 €. Zudem benötigen Betreiber in bestimmten Risikokategorien zusätzliche Genehmigungen, etwa für Flüge über Menschenansammlungen oder außerhalb der Sichtweite. Diese Genehmigungsverfahren können mehrere Wochen oder sogar Monate dauern und erfordern oft detaillierte Risikobewertungen.
| Anforderung | Hobbypilot | Gewerblicher Betreiber |
|---|---|---|
| Lizenz | EU-Kompetenzzeugnis (falls nötig) | EU-Fernpilotenzertifikat (falls nötig) |
| Versicherung | Pflicht (30–100 €/Jahr) | Pflicht (200–500 €/Jahr) |
| Registrierung | Ab 250 g oder mit Kamera | Immer erforderlich |
| Betriebsbeschränkungen | Standard No-Fly-Zonen | No-Fly-Zonen plus zusätzliche Genehmigungen |
Compliance-Probleme lösen
Die neuen Regelungen bringen Herausforderungen mit sich, insbesondere bei der korrekten Einordnung des geplanten Einsatzes und der Vorbereitung auf Prüfungen. Um den Einstieg zu erleichtern, bieten strukturierte Lernmaterialien Unterstützung, die speziell auf die deutschen Anforderungen zugeschnitten sind.
Eine gründliche Planung ist entscheidend: Registrierung, Versicherungsabschluss und Lizenzierung sollten vor dem ersten Flug abgeschlossen sein. Gewerbliche Betreiber müssen zusätzlich längere Bearbeitungszeiten für Genehmigungen einkalkulieren. Da sich Luftraumbestimmungen und No-Fly-Zonen regelmäßig ändern können, wird auch die kontinuierliche Weiterbildung immer wichtiger. Apps wie DRONIQ helfen dabei, aktuelle Beschränkungen im Blick zu behalten – ein solides Verständnis der Regelungen bleibt jedoch unverzichtbar.
Vorbereitung auf 2025 und darüber hinaus
Die EU-Drohnenverordnung 2025 bringt für Drohnenpiloten in Deutschland neue, strengere Vorschriften mit sich. Wer seine Drohne weiterhin legal nutzen möchte, muss diese Anforderungen erfüllen. Hier erfahren Sie, wie Sie die neuen Regeln umsetzen können.
Drohnen, die mehr als 250 Gramm wiegen oder mit einer Kamera ausgestattet sind, müssen registriert werden. Die Registrierungskosten liegen zwischen 20 und 50 €. Zudem ist je nach Einsatzbereich ein EU-Kompetenzzeugnis (30–60 €) oder ein EU-Fernpilotenzertifikat (200–500 €) erforderlich. Verstöße gegen die Vorschriften können mit Geldbußen von bis zu 50.000 € geahndet werden [1].
“Der Betrieb einer Drohne ohne angemessene Kenntnisse der Luftfahrtregeln kann zu Unfällen oder gefährlichen Situationen führen, insbesondere in städtischen oder eingeschränkten Gebieten. Eine Drohnenlizenz stellt sicher, dass der Pilot die Sicherheitsprotokolle versteht und einhält und dabei Menschen, Eigentum und die Umwelt schützt.”
- Editorial Team, KUMMUNI [1]
Ab 2026 dürfen Drohnen ohne CE-Kennzeichnung nur noch in der A3-Unterkategorie betrieben werden, also ausschließlich in unbewohnten Gebieten. Diese Regelung betrifft vor allem Unternehmen, die Drohnen für Luftaufnahmen, Kartierungen oder Inspektionen einsetzen. Die CE-Kennzeichnung wird damit zu einem zentralen Faktor für flexible Einsätze. Gleichzeitig wird die Bedeutung regelmäßiger Updates und kontinuierlicher Schulungen immer größer.
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) aktualisieren ihre Vorschriften regelmäßig. Piloten müssen sich daher kontinuierlich über Änderungen informieren, beispielsweise zu No-Fly-Zonen, Luftraumbestimmungen und Betriebsanforderungen [1].
Um sich optimal auf Prüfungen vorzubereiten, bietet Drohnenprüfung Deutschland umfassende Lernmaterialien mit über 150 Prüfungsfragen für die A1/A3- und A2-Zertifizierung an. Diese Materialien werden lebenslang aktualisiert und kosten 21,99 € für die A1/A3-Zertifizierung und 49,99 € für die A2-Zertifizierung. Für zusätzliche Unterstützung gibt es einen 1:1-Lizenzservice für 149 €, der Live-Prüfungsbetreuung und Hilfe bei der Registrierung umfasst.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Versicherungsschutz. Private Haftpflichtversicherungen kosten etwa 30–100 € pro Jahr, während gewerbliche Policen zwischen 200 und 500 € jährlich liegen. Ohne gültige Versicherung entfällt der Schutz im Schadensfall [1].
Vor jedem Flug sollten Pre-Flight-Checks durchgeführt werden. Dazu gehören die Überprüfung des Drohnenzustands, der Firmware und der Wetterbedingungen. Diese Maßnahmen sind ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung und helfen, kostspielige Unfälle zu vermeiden [1].
FAQs
Welche Voraussetzungen gelten ab 2025, um eine Drohne in Deutschland legal zu fliegen?
Voraussetzungen für Drohnenpiloten ab 2025 in Deutschland
Ab 2025 gelten in Deutschland klare Regeln für den Betrieb von Drohnen. Wer seine Drohne legal fliegen möchte, muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Registrierung: Drohnen, die mehr als 250 Gramm wiegen oder mit Sensoren ausgestattet sind, die personenbezogene Daten erfassen können, müssen beim Luftfahrtbundesamt (LBA) registriert werden. Nach der Registrierung erhält die Drohne eine sichtbare Registrierungsnummer, die sogenannte e-ID.
- Drohnenführerschein: Abhängig von der Drohnenklasse ist entweder ein EU-Kompetenznachweis (A1/A3) oder ein EU-Fernpilotenzeugnis (A2) erforderlich. Der Kompetenznachweis (A1/A3) ist dabei die Grundlage für den Erwerb des erweiterten A2-Zertifikats.
- Haftpflichtversicherung: Für jeden Drohnenflug ist eine gültige Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Ohne diese Versicherung darf keine Drohne betrieben werden.
- Betriebskategorie: Jede Drohne muss einer der drei Betriebskategorien zugeordnet werden: Offene, Spezielle oder Zulassungspflichtige Kategorie. Für jede Kategorie gelten spezifische Vorschriften, die eingehalten werden müssen.
Neben diesen Anforderungen gibt es allgemeine Sicherheitsregeln, die stets beachtet werden müssen. Dazu zählen unter anderem eine maximale Flughöhe von 120 Metern, das Fliegen nur in Sichtweite (VLOS) und das Vermeiden von Flügen über Menschenansammlungen. Diese Vorgaben sollen nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen gewährleisten.
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Kategorien ‘Open’, ‘Specific’ und ‘Certified’ in der EU-Drohnenverordnung 2025?
Die EU-Drohnenverordnung 2025: Kategorien im Überblick
Die EU-Drohnenverordnung 2025 unterteilt Drohnenoperationen in drei Kategorien: Open, Specific und Certified. Jede dieser Kategorien richtet sich nach dem Risikograd der jeweiligen Drohneneinsätze und bringt spezifische Vorschriften mit sich.
- Open: Diese Kategorie deckt die meisten Freizeitflüge und einige kommerzielle Anwendungen mit geringem Risiko ab. Drohnen dürfen maximal 25 kg wiegen und müssen grundlegende Sicherheitsstandards erfüllen. Eine Registrierung ist ab einem Gewicht von 250 g erforderlich. Für schwerere Modelle wird zusätzlich ein EU-Drohnenführerschein verlangt.
- Specific: Einsätze mit mittlerem Risiko, wie beispielsweise industrielle Inspektionen, fallen in diese Kategorie. Hier ist eine detaillierte Risikoanalyse notwendig, ebenso wie eine Genehmigung der zuständigen Luftfahrtbehörden. Betreiber müssen ihre geplanten Einsätze im Voraus präzise dokumentieren und einreichen.
- Certified: Diese Kategorie betrifft hochkomplexe und risikoreiche Operationen, etwa den Transport von Waren oder Passagieren. In diesem Fall sind umfangreiche Zertifizierungen erforderlich – nicht nur für die Drohne selbst, sondern auch für die Betreiber und Piloten.
Die Regel lautet: Je höher das Risiko eines Drohneneinsatzes, desto strenger werden die Anforderungen an Registrierung, Genehmigungen und Zertifizierungen.
Welche Regeln gelten ab 2025 für die Registrierung und Versicherung von Drohnen in Deutschland?
Ab 2025 sind alle Drohnenpiloten in Deutschland verpflichtet, sich beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) zu registrieren – unabhängig vom Gewicht ihrer Drohne. Eine Ausnahme gibt es lediglich für Drohnen, die weniger als 250 Gramm wiegen und keine Sensoren wie Kameras besitzen. Im Rahmen der Registrierung erhalten Betreiber eine eID (UAS-Betreiber-ID), die deutlich sichtbar an der Drohne angebracht werden muss.
Darüber hinaus besteht eine gesetzliche Pflicht, eine Haftpflichtversicherung für jede Drohne abzuschließen. Die Versicherungsnummer ist Teil der erforderlichen Angaben bei der Registrierung. Diese Regelungen betreffen auch Drohnen der Klassen C0 und C1. Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihre Drohne als auch Ihr Betrieb den neuen Vorschriften entsprechen, um mögliche Bußgelder zu vermeiden.
📄 Kostenlose Vorschau gefällig?
Lade dir hier das Muster-PDF mit echten Prüfungsfragen inkl. Antwort-Erklärungen herunter ➡️link hier
✅ Alle korrekten Antworten + vollständige Frageliste zur 2026 Drohnenprüfung findest du hier:
➡️ www.drohnenfuhrerschein.de/product/deutschland-drohnenprufung-a1-a3-alle-fragen-antworten/
🚀 Wir haben auch Vorbereitungstests für die A2 Drohnenprüfung
Lade dir hier das Muster-PDF mit echten Prüfungsfragen inkl. Antwort-Erklärungen herunter: A2-Drohnenführerschein